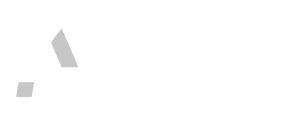Stresstests für Klimarisiken
Hintergrund
Der Klimawandel ist eine der komplexesten Herausforderungen, vor denen die Gesellschaft heute steht. Die seit der industriellen Revolution anhaltenden und steigenden Treibhausgasemissionen haben zwar zu einem Anstieg des BIP geführt, jedoch um den Preis steigender Temperaturen, die Risiken für Leben, Ökosysteme und Volkswirtschaften mit sich bringen. Es besteht zunehmend Einigkeit darüber, dass die Risiken des Klimawandels erhebliche Auswirkungen auf das Finanzsystem haben können. Aus diesem Grund werden verstärkt Anstrengungen unternommen, um die Exponierung von Finanzinstituten gegenüber klimabezogenen Risiken durch Klimarisikostresstests zu bewerten.
Klimarisiken lassen sich in drei große Kategorien einteilen: physische Risiken, Übergangsrisiken und Haftungsrisiken. Physische Risiken sind unmittelbare Gefahren, die von der physischen Umwelt ausgehen. Sie entstehen durch extreme Wetterereignisse wie Überschwemmungen, Hurrikane, Dürren oder Waldbrände. Übergangsrisiken entstehen durch potenzielle Kosten, die durch die Einführung von politischen Maßnahmen, Gesetzen und anderen Vorschriften zur Anpassung an eine kohlenstoffarme Wirtschaft entstehen. Transitionsrisiken entstehen auch durch technologische Veränderungen und Veränderungen in der Kundenstimmung. Die dritte Risikokategorie, Haftungsrisiken, ergibt sich ebenfalls aus dem Klimawandel und der Transition. Haftungsrisiken entstehen durch das Versäumnis, sich an veränderte gesetzliche und regulatorische Erwartungen anzupassen, diese offenzulegen oder einzuhalten[1]. Derzeit werden Haftungsrisiken in Klimarisikostresstests für Finanzinstitute in der Regel nicht berücksichtigt (Baudino und Svoronos, 2021).
Finanzinstitute sind durch ihre Geschäftstätigkeit direkt klimabezogenen Risiken ausgesetzt. So können Banken beispielsweise von steigenden Energiekosten oder Kosten für ihre physische Infrastruktur betroffen sein, und ihre Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten können extremen Wetterereignissen ausgesetzt sein. Indirekt sind Banken durch die makroökonomischen Auswirkungen disruptiver Transformationspfade und extremer Wetterereignisse klimabezogenen Risiken ausgesetzt. Diese wirtschaftlichen Auswirkungen können sich negativ auf die Ausfallquote von Krediten und die Marktpreise von Wertpapieren im Besitz von Finanzinstituten auswirken (Baudino und Svoronos, 2021). Derzeit bieten Versicherungsverträge nur begrenzten Schutz vor diesen Risiken, und in Ländern mit weniger entwickelten Finanzsektoren ist ein solcher Schutz nicht verfügbar (BIZ, 2020).
Seit dem Pariser Abkommen von 2015 wurden Initiativen zur Bewältigung von Klimarisiken im Finanzsektor ergriffen, beginnend mit einer verbesserten Offenlegung. Im Jahr 2017 hat der Finanzstabilitätsrat (FSB) der G20 die Task Force for Climate-Related Financial Disclosure (TCFD) ins Leben gerufen, die Empfehlungen zur Offenlegung von Klimarisiken gibt. Im selben Jahr gründete eine Gruppe von Zentralbanken und Finanzaufsichtsbehörden das Network for Greening the Financial System (NGFS). Das NGFS hat die Bemühungen zur Einbeziehung klimabezogener Risiken in die Rahmenwerke für Finanzstabilität verstärkt (NGFS, 2020). Darüber hinaus hat die Europäische Kommission (EK) die Hochrangige Expertengruppe für nachhaltige Finanzen (HLEG) eingerichtet, die die Einführung von Standards für die Identifizierung nachhaltiger Investitionen empfohlen hat. Diese Empfehlungen wurden in den Aktionsplan der EK für nachhaltige Finanzdienstleistungen von 2018 aufgenommen und dienten als Leitlinien für die Arbeit der Technischen Expertengruppe für nachhaltige Finanzdienstleistungen (TEG) der EK (siehe Europäische Kommission, 2020), die im Juni 2020 zur Veröffentlichung der EU-Taxonomieverordnung im Amtsblatt der Europäischen Union führte.
Zürich. „So wird sich der Klimawandel auf Unternehmen überall auswirken – und was kann dagegen getan werden?“ https://www.zurich.com/en/knowledge/topics/climate-change/how-climate-change-will-impact-business-everywhere
Diese beispiellosen Initiativen zielen darauf ab, quantitative Rahmenwerke zu schaffen, mit denen die Risikoexposition und potenzielle Verluste aufgrund des Klimawandels bewertet werden können. Die Quantifizierung von Klimarisikofaktoren liefert wichtige Informationen für die Entscheidungsfindung von Banken sowohl in Bezug auf finanzielle als auch auf nichtfinanzielle Risiken. Die Messung ist wichtig, da Posten, die nicht gemessen werden können, in der Regel auch nicht verwaltet, geplant, berichtet und offengelegt werden können.
Eine zentrale Herausforderung für Finanzinstitute bei der Quantifizierung klimabezogener Risiken ist der Mangel an relevanten Daten. Traditionelle Methoden zur Risikoquantifizierung stützen sich auf historische Daten und statistische Risikomodelle. Im Gegensatz zur traditionellen Risikoanalyse sind jedoch möglicherweise keine Daten für Klimarisiken verfügbar, da Übergangsrisiken beispiellos sind. Darüber hinaus können physische Risikodaten irrelevant oder unzuverlässig sein, da die Wetterbedingungen nicht konstant sind, sondern immer extremer und unvorhersehbarer werden. Außerdem wurden von Finanzinstituten keine Daten erhoben, da die Risiken des Klimawandels als nicht wesentlich angesehen wurden und solche Bemühungen daher nicht gerechtfertigt waren (Baudino und Svoronos, 2021).
Um diese Herausforderung bei der Quantifizierung klimabezogener Risiken zu bewältigen, setzen Institutionen auf Stresstests. Stresstests sind Simulationsübungen, mit denen die Widerstandsfähigkeit einer einzelnen Bank oder des gesamten Systems gegenüber einem hypothetischen Szenario bewertet wird (Baudino et al. (2018)). Stresstests sind eine Antwort auf die Herausforderung der Klimarisiken, da sie zukunftsorientiert sind. Sie untersuchen künftige Risiken und potenzielle Verluste, die sich nicht aus vergangenen Daten ableiten lassen. Sie geben nicht vor, zu prognostizieren, welches Zukunftsszenario tatsächlich eintreten wird, sondern beschreiben vielmehr das Spektrum möglicher künftiger Ergebnisse. Stresstestmethoden sind den Banken vertraut, da sie bereits heute Stresstests für das Risikomanagement, die Planung und zur Einhaltung regulatorischer Vorschriften durchführen.
Im Jahr 2019 empfahl das NGFS die Verwendung von Klimastresstests zur Bewertung der Auswirkungen von Klimarisiken auf die Finanzstabilität (NGFS, 2019) und stellte 2020 eine Reihe von Standardklimaszenarien vor, die Anleger bei der Bewertung ihrer klimabezogenen Finanzrisiken berücksichtigen sollten (NGFS, 2020). Stresstest-Szenarien und Modellierungstechniken wurden von den Behörden entwickelt und zur Verwendung in verschiedenen Rechtsordnungen öffentlich zugänglich gemacht.
Ziel dieses Papiers ist es, die Gestaltungsmerkmale eines Klimarisiko-Stresstests für Banken unter Verwendung des NGFS-Rahmens zu bewerten. Wir beleuchten die vom NGFS verwendeten Methoden und die wichtigsten Herausforderungen, die mit der Einbeziehung dieses Rahmens verbunden sind.
Umsetzung
NGFS-Rahmen für die Szenariodesign
Die NGFS hat in Abstimmung mit Klimawissenschaftlern und Ökonomen eine Reihe hypothetischer Szenarien entwickelt, die als Referenzpunkt dienen, um zu verstehen, wie sich der Klimawandel (physisches Risiko) und klimapolitische und technologische Trends (Transitionsrisiko) in verschiedenen Zukunftsszenarien entwickeln könnten.
Im Rahmen des NGFS werden die Szenarien in vier Kategorien eingeteilt: (i) die Kategorie „Treibhauswelt“, (ii) die Kategorie „zu wenig, zu spät“, (iii) die Kategorie „geordneter Übergang“ und (iv) die Kategorie „ungeordneter Übergang“.
Das NGFS hat keine spezifischen Szenarien für den Pfad „zu wenig, zu spät“ entworfen. Für jede der drei anderen Kategorien werden zwei detaillierte Szenariooptionen bereitgestellt. Diese Optionen spiegeln eher die politischen Entscheidungen der zuständigen Behörden, den technologischen Wandel und die hohe Unsicherheit hinsichtlich der Ergebnisse wider, insbesondere in Bezug auf physische Risiken.
Ordnungsgemäße Szenarien
Netto-Null 2050. Die globale Erwärmung wird durch strenge Klimapolitik und Innovationen auf 1,5 °C begrenzt. Die globalen CO2-Emissionen werden um 2050 auf netto null gesenkt. Einige Länder (z. B. die Vereinigten Staaten, die Europäische Union und Japan) erreichen Netto-Null für alle Treibhausgase.
Unter 2 °C. Die Klimapolitik wird schrittweise verschärft, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass die globale Erwärmung unter 2 °C bleibt, bei zwei Dritteln liegt.
Chaotische Szenarien
Divergierende Netto-Null. Die Emissionen erreichen um 2050 Netto-Null, jedoch mit höheren Kosten aufgrund divergierender Maßnahmen in verschiedenen Sektoren, die zu einer schnelleren Abkehr vom Öl führen.
Verzögerter Übergang. Hier wird davon ausgegangen, dass die jährlichen Emissionen bis 2030 nicht sinken. Um die Erwärmung auf unter 2 °C zu begrenzen, sind strenge und harte Maßnahmen erforderlich. Die CO2-Entfernung ist begrenzt. Die physischen Risiken und Übergangsrisiken sind aufgrund der Verzögerung höher.
Treibhaus-Szenarien (d. h. die aktuellen Maßnahmen werden umgesetzt, aber es werden keine zusätzlichen Maßnahmen ergriffen)
National festgelegte Beiträge (NDCs). Dies umfasst alle zugesagten Maßnahmen, auch wenn sie noch nicht umgesetzt sind. Da diese nicht ausreichen, um bis 2050 Netto-Null zu erreichen, steigt die Durchschnittstemperatur bis zu diesem Zeitpunkt um 2,5 °C.
Aktuelle Politik. Dabei wird davon ausgegangen, dass nur die derzeit umgesetzten Maßnahmen umgesetzt werden, was dem „Worst-Case-Szenario” entspricht. Infolgedessen steigt die Durchschnittstemperatur um mehr als 3 °C, wobei sich die Häufigkeit und Schwere von extremen Wetterereignissen wie Hitzewellen, Dürren, Waldbränden, tropischen Wirbelstürmen und Überschwemmungen verändern. Dies hat Auswirkungen auf die Gesundheit, die Arbeitsproduktivität, die Landwirtschaft, die Ökosysteme und den Meeresspiegel.
Modellierungsansätze
Die Übergangswege für die NGFS-Szenarien wurden mit Hilfe etablierter integrierter Bewertungsmodelle (IAMs) erstellt, nämlich GCAM, MESSAGEix-GLOBIOM und REMIND-MAgPIE. IAMs quantifizieren die Auswirkungen des Klimawandels auf makroökonomische Variablen. Diese Modelle wurden in Hunderten von begutachteten wissenschaftlichen Studien zur Eindämmung des Klimawandels verwendet. IAMs verknüpfen die Prognosen der Treibhausgasemissionen mit einem entsprechenden Satz von Kohlenstoffpreisen, Energiebedarf und -preisen sowie den Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum. Die IAM-Modelle liefern BIP-Pfade, Kohlenstoffpreise, Energiepreise und -nachfrage sowie Treibhausgasemissionen für die Szenarien. Diese Variablen werden dann als Inputs in makroökonomische Modelle eingegeben und auf Länderblöcke angewendet, um regionale Ergebnisse zu erhalten. Die Modellrahmen werden durch ein sektorales Modell zur Bewertung der wirtschaftlichen Auswirkungen auf bestimmte Sektoren und durch Finanzmodelle zur Bewertung unternehmensspezifischer und risikospezifischer Auswirkungen ergänzt (Baudino und Svoronos, 2021).
GCAM, MESSAGEix-GLOBIOM und REMIND-MAgPIE haben eine ähnliche Struktur. Sie kombinieren makroökonomische, landwirtschaftliche und Landnutzungs-, Energie-, Wasser- und Klimasysteme zu einem gemeinsamen numerischen Rahmen, der die Analyse der nichtlinearen Dynamiken innerhalb dieser Komponenten und zwischen ihnen ermöglicht. Trotz ihrer Ähnlichkeiten hat jedes der Modelle seine eigenen Merkmale, die die Ergebnisse beeinflussen können. Beispielsweise gehen sowohl MESSAGEix-GLOBIOM als auch REMIND-MAgPIE von einer perfekten Vorhersagefähigkeit aus. Das bedeutet, dass die Teilnehmer des Modells alle Veränderungen, die im Laufe des 21. Jahrhunderts eintreten, vollständig vorhersehen können. Im Gegensatz dazu hat das GCAM-Modell eine „kurzsichtige” Sicht auf die Zukunft, was bedeutet, dass die Teilnehmer bei der Formulierung ihres Verhaltens, einschließlich ihrer Erwartungen für die Zukunft, nur vergangene und gegenwärtige Umstände berücksichtigen. Diese Unterschiede wirken sich auf die Endergebnisse der Modelle aus (NGFS, 2021).
Ergebnisse
Klimastresstests der Zentralbanken liefern ihnen wichtige Informationen über die Widerstandsfähigkeit des gesamten Finanzsystems gegenüber Klimarisiken. Für einzelne Banken bieten Stresstests ein besseres Verständnis der Risiken des Sektors sowie der Widerstandsfähigkeit und Anfälligkeit ihrer Kunden. Diese Maßnahme ist nützlich, um Finanzinstitute bei der Anpassung ihres Risikomanagements oder der Neugewichtung ihrer Risiken zu unterstützen. Sie liefert dem Management Informationen, die für die Festlegung von Maßnahmen zur Risikominderung und die Verabschiedung von Übergangsplänen nützlich sein können. Banken können ihre Kreditportfolios „grüner“ gestalten, indem sie mit ihren Kunden verbindliche Übergangspläne und Übergangsinvestitionen vereinbaren. Der Klimawandel ist somit ein unmittelbares Risiko, aber auch eine Geschäftschance für Banken: Der Klimawandel muss finanziert werden (u. a. von Banken).
Die Ergebnisse von Stresstests sind jedoch oft mit Vorsicht zu genießen. Laut BIZ (2021) könnten Angaben zu potenziellen langfristigen Verlusten fragwürdig und möglicherweise kontraproduktiv sein, da die Schätzungen mit sehr hoher Unsicherheit behaftet sind und das Risiko besteht, dass sie negative Reaktionen der Marktteilnehmer hervorrufen oder sogar Marktturbulenzen auslösen könnten.
Herausforderungen
Eine der größten Herausforderungen bei der Durchführung von Klimarisikostresstests ist der Mangel an Daten. Erstens sind Daten über zukünftige Klimamuster aufgrund der Veränderungen der Klimamuster und Wetterbedingungen möglicherweise nicht verfügbar oder unzuverlässig. Darüber hinaus erfordert die Messung der Auswirkungen von Klimarisiken detaillierte Daten darüber, inwieweit Sektoren und Kunden Klimarisiken ausgesetzt sind. Diese Informationen sollten idealerweise nach Sektoren und Regionen kategorisiert werden, um Risiken entlang dieser Dimensionen zu differenzieren und zu bewerten. Diese Daten sind jedoch oft nicht verfügbar (Baudino und Svoronos, 2021).
Da Klimarisikostresstests noch in den Kinderschuhen stecken, gibt es noch keine etablierten, gemeinsamen Vorgehensweisen für Finanzinstitute. Zwar besteht Einigkeit darüber, welche Sektoren die meisten CO2-Emissionen verursachen, doch gibt es unterschiedliche Methoden, wie sich die CO2-Steuer auf die Wirtschaft auswirkt. Die Verwendung unterschiedlicher Methoden (wie die drei zuvor beschriebenen Simulationsrahmen) schränkt die Vergleichbarkeit der Ergebnisse von Stresstests ein. Daher könnte es von Vorteil sein, gemeinsame Grundlagen zu entwickeln.
Aufgrund fehlender Daten, Methoden und Standards sind die Auswirkungen von Klimarisikostresstests noch „weicher” als bei der Belastung traditioneller Risiken.
Während traditionelle Solvenzrisikostresstests regulatorische Auswirkungen haben, müssen die Auswirkungen von Klimarisikostresstests auf die Politik noch definiert werden. Es ist noch nicht geklärt, ob Klimastresstests eine geeignete Grundlage für quantitative Anforderungen sind oder ob sie sich besser als Auslöser für gezielte Diskussionen zwischen Aufsichtsbehörden und Finanzunternehmen eignen. Einige argumentieren, dass die Risiken des Klimawandels zu gering sind, um das Finanzsystem wesentlich zu beeinflussen, und dass die Klimafinanzregulierung ein Versuch ist, Gesetze zu verabschieden, die sonst nicht eigenständig bestehen würden (Cochrane, 2021). Dennoch stehen Banken unter zunehmendem regulatorischem und kommerziellem Druck, sich vor den Auswirkungen des Klimawandels zu schützen und sich an der globalen Nachhaltigkeitsagenda auszurichten. Daher ist es unerlässlich, die Bewertung und das Management von Klimarisiken zu verbessern.
Fazit
Stresstests für Klimarisiken sind relativ neu und komplex. Weltweit bauen Finanzaufsichtsbehörden und Banken schrittweise Kapazitäten auf. Stresstests und die Art und Weise, wie Finanzinstitute auf deren Ergebnisse reagieren, können in Diskussionen über Geschäftsmodelle, interne Governance, Beratungsleistungen für den Übergang und das damit verbundene Risikomanagement einfließen. Insgesamt müssen Banken langfristige Strategien für ihr Geschäftsmodell entwickeln, um die Risiken der Dekarbonisierung der Volkswirtschaften zu messen und zu finanzieren. Dies wird in naher Zukunft eine wichtige Priorität sein.
Referenzen
- Baudino P und Svoronos JP. 2021. Stress-testing banks for climate change – a comparison of practices.
- Cochrane J. 2021. Climate Financial Risk. https://johnhcochrane.blogspot.com/2021/07/climate-risk-to-financial-system.html
- Finanzstabilitätsrat (2020). Die Auswirkungen des Klimawandels auf die Finanzstabilität, November.
- Netzwerk für die Ökologisierung des Finanzsystems (2021). NGFS-Klimaszenarien für Zentralbanken und Aufsichtsbehörden.
- Netzwerk für die Ökologisierung des Finanzsystems (2021). „Fallstudien zu Methoden für Umweltrisiken“, NGFS Occasional Paper.